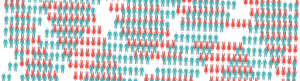 Alle zwei Jahre versammelt sich die institutionell verfasste Soziologie des Landes zu einem Kongress. Dieser dient nicht nur der Diskussion fachlicher Erkenntnisse oder dem Ausfechten von metatheoretischen Grabenkämpfen, sondern bietet immer auch Anlass zur (Selbst-) Reflexion und Kritik. Zu den DGS-Kongressen der vergangenen Jahre fest dazu gehören Beschwerden über die geringe öffentliche Sichtbarkeit, und Anzeichen der verschlafenen Digitalisierung (wobei der Diekmann-Artikel m.E. keine angemessene Kritik ist).
Alle zwei Jahre versammelt sich die institutionell verfasste Soziologie des Landes zu einem Kongress. Dieser dient nicht nur der Diskussion fachlicher Erkenntnisse oder dem Ausfechten von metatheoretischen Grabenkämpfen, sondern bietet immer auch Anlass zur (Selbst-) Reflexion und Kritik. Zu den DGS-Kongressen der vergangenen Jahre fest dazu gehören Beschwerden über die geringe öffentliche Sichtbarkeit, und Anzeichen der verschlafenen Digitalisierung (wobei der Diekmann-Artikel m.E. keine angemessene Kritik ist).
Die Stoßrichtung dieser Kritiken kann man nur begrüßen – und sich wundern, das so wenig zu ihrer Bearbeitung geschieht. Ich persönlich finde es frappierend, wie wenig ausgerechnet eine Fachgesellschaft der Soziologie in der Lage ist, ihre konkreten Sozial-und Kommunikationsformen zu aktualisieren. Ich habe auch dieses Jahr einige frustrierende Momente mit dem Programm und seiner Umsetzung erlebt. Dementsprechend will ich das Problem der fragmentierten und zuweilen auch zahnlosen soziologischen Öffentlichkeit hier in ganz pragmatischen Vorschlägen thematisieren. [Eine ganze Reihe von scheinbar kleinen Dingen kann der DGS-Kongress ürbigens sehr gut: Kinderbetreuung, frisches Obst, freundliche und zahlreiche Helfer*innen, Nutzung von ConfTool und Conference4Me, …]
1. Kürzere Zeitslots
Ein Tag auf dem Soziologiekongress zerfällt im Grunde nur in zwei Einheiten: Eine knapp dreistündige Vormittags- und Nachmittagssession. Dazwischen und danach finden Vorlesungen oder Versammlungen (der Sektionen bspw.) statt. Drei Stunden gefüllt mit fünf Vorträgen sind schlicht zu lang. Niemand kann drei Stunden am Stück konzentriert arbeiten. Außerdem wird das Wechseln zwischen den Sessions bei längerer Slot-Dauer immer schwerer. Damit reduziert sich die Zahl an besuchbaren Sessions.
Der 90-Minüter mit drei Vorträgen scheint mir die angemessenste Strukturierung, um diesen Problemen zu begegnen. Das würde auch verhindern, dass trotz der absoluten Zeitbot (Verfügbarkeit von Slots) aquch noch eine relative hinzu kommt: sich nämlich alles Interessierende auch noch ballt.
2. Programmstruktur integrieren
Die Soziologie ist wie viele wissenschaftliche Disziplinen hochgradig divers: theoretisch, methodisch und als Fachgesellschaft auch organisatorisch. Das mach sich im Programm an der herausgehobenen Rolle der Sektionen bemerkbar, die sieben der großen Slots besetzen. Die vor einigen Jahren eingeführten Adhoc-Gruppen laufen nicht nur zeitlich parallel dazu: Auch inhaltlich gibt es keine Querverweise zwischen von Sektionen und „Einzelnen“ organisierten Veranstaltungen. Das Kongressprogramm ist inhaltlich dadurch nicht integriert. Interessiert man sich bspw. für Digitalisierung kämpft man mit Überschneidungen: Ein spannender Vortrag zur Digitalisierung in der Wirtschaftssoziologie am Dienstagnachmittag liegt parallel zu einer thematischen Sessiond er Techniksoziologie, am Mittwochvormi8ttag kreuzt sich der zweite Teil dieser Session mit einer Adhoc-Gruppe zu Smart Devices. Die absurde Folge: Christians Papsdorf, der die Adhoc-Gruppe leitet, kann diese nicht besuchen, da er einen Vortrag in der Techniksoziologie-Sektionsveranstaltung hält.
Wenn die Sektionen schon so eine prominente Rolle haben und so viel Raum im Programm einnehmen, dann sollten ihre Beiträge besser mit den Themen und Inhalten der Adhoc-Gruppen koordiniert werden. Das kann bspw über die Verwendung von Schlagworten für Vorträge bzw. Sessions geschehen. Da muss auch niemand an einer Tafel stehen und sich am Kopf kratzen, das lässt sich mit Software recht einfach in eine möglichst kollisionsfreie Form bringen.
3. Gemeinsame Sektionsveranstaltungen
Die Kultur- und die Rechtssoziologie haben am Mittwoch eine gemeinsame Veranstaltung zu Rechtskulturen gehalten. Das war inhaltlich sehr gut und hat zudeme inige schöne Nebenfolgen gehabt: Wissenschaftler*innen die zu ähnlichen Themen arbeiten, sind sich produktiv näher gekommen. Wie auf einem Kongress! Ähnliches habe ich schon auf gemeinsamen Sektionstagungen wie zB im Januar 2013 (Wissenssoziologie und Wissenschaftsforschung) erlebt. Es ist doch absurd, wenn Praktiken bestimmter Berufsgruppen (bsp Lehrer, Behördenmitarbeiter ode Wissenschaftler selbst) getrennt voneinander aus den Augen der Professionssoziologie, einem thematischen Plenum und drittens Adhoc-Gruppen verhandelt wird.
Das Zusammenlegen von Sektionsveranstaltungen, bzw der organisatorische Zwang zu gemeinsamen Sessions mit gemeinsamen Themen hat eine Menge Vorteile: Nicht nur wird Raum im Programm frei, auch Austausch und Multiperspektivität wird gefördert. Ich ahne, welche Empörung so ein Vorschlag unter Menschen auslöst, die zuerst überlegen, ob ihnen dadurch nicht etwas weggenommen würde. Hier geht es aber nicht um akademische Egos, sondern um Pragmatismus und Produktivität.
4. Offizielle und inoffizielle Kongressöffentlichkeit vermischen
Ohne dass ich die deutsche Soziologie empirisch erforscht habe – wohl aber andere Fachkulturen – muss ich leider feststellen, dass die Kommunikationskultur der DGS-Kongresse sehr statusorientiert ist. Neben einer Menge Altherrengehabe, das man wohl überall findet, betrifft das vor allem den äußerst geringen Austausch zwischen Professorinnen und Professoren und allen anderen Anwesenden. Einzig einige Plenar-Veranstaltungen und einige Sektionsveranstaltungen weisen eine hohe Durchmischung der Akteure auf, in Adhoc-Gruppen bleiben die Jungen unter sich, auf den Podien sitzen nur Berufene.
Das zu ändern erfordert eigentlich nicht viel, lässt sich aber schwer organisatorisch erzwingen. Theoretisch wäre eine besserer Austausch auch jetzt schon möglich. Er geschieht nur nicht. Ein einfacher Vorschlag scheint mir, die „inoffizielle“ (wenn auch zahlenmäßig weit überlegene) Kongressöffentlichkeit besser sichtbar zu machen. Twitter wäre ein Weg dazu – obwohl ich ahne, dass ich anders twittern würde, wenn ich wüsste, dass die gesamte Kongressöffentlichkeit mitliest. Die „Bamberger Splitter“ von Soziopolis haben auch das Zeug dazu beizutragen. Ansonsten passiert das natürlich auch auf der Kongressparty. Können wir auch gern jeden Tag machen.
