Ich bin derzeit auf der „Mensch und Computer 2013“ einer Konferenz, die Professionals und Wissenschaftlerinnen aus dem Bereich Mensch-Computer-Interaktion anspricht. Damit sind so unterschiedliche Tätigkeitsbereiche wie Websiten-Optimierung für Shoppingportale oder die Entwicklung neuer Hardware-Schnittstellen gemeint, wie auch Bedürfnis- und Nutzungsanalysen verschiedener Zielgruppen.
Für ebenjenes interdisziplinäres Zielpublikum haben Benny Liebold und ich einen Workshop konzipiert, der methodische und methodologische Probleme des Zugangs zu „Interaktion“ zwischen Mensch und Computer thematisiert [Update: Diskussionseinblick hier]. Im Rahmen dieses Workshops und anderer Vorträge auf der Konferenz hat sich eine Frage als drängend erwiesen, die ich gern hier und in den Comments mit euch diskutieren möchte:
Wie lassen sich Ergebnisse qualitativer Forschung in Projekten mit Schnittstellen zu Informationstechnik anschlussfähig kommunizieren?
Um überhaupt auf diese Frage antworten zu können, möchte ich versuchen, dass damit behauptete Problem – die geringere Anwendung und/oder Anwendbarkeit rekonstruktiv gewonnener Beschreibungen sozialer Welt für Mensch-Maschine-Schnittstellen – zu verstehen. Meiner Beobachtung nach speist sich das Problem aus zwei kulturellen Übersetzungsproblemen, die ich kurz anführen will.
Zunächst einmal berichten vor allem Entwerfer aus der Wirtschaft, dass ihre Vorgaben nahezu ausschließlich aus quantifizierbaren Zielen bestehen. Ein Teilnehmer des gestrigen Workshops sagte wörtlich: „Mein Chef will halt, dass da am Ende eine Zahl bei herauskommt.“ Die Tendenz, Erfolgsfaktoren zu messen anstatt zu verstehen, ist überall dort anzutreffen, wo Problemlösungen zuvorderst an Effizienz gemessen werden. Bereits formalisierte Daten, die Komplexität reduzieren, bilden die Struktur der Entscheidungen, die in diesem Modus Operierende zu treffen haben, einfach besser ab. Die Zielvorgabe der Steigerung des Absatzes um X %, lässt sich leichter in einer quantitativen Metrik für die Benutzbarkeit eines Online-Shops als bearbeitbar kommunizieren. Ein nachvollziehendes Nutzererleben ist dafür nicht direkt tauglich. Das Übertragungsproblem für die Ergebnisse sog. qualitativer Forschung bestünde dementsprechend in deren offenbar zu geringer Komplexitätsreduktionsfähigkeit, um anschlussfähig für trivialökonomische Entscheidungen zu sein.
Am Punkt Komplexitätsreduktion setzt auch das zweite Übersetzungsproblem an. Um überhaupt arbeitsfähig zu sein, müssen notwendigerweise Faktoren zur Bearbeitung selektiert werden. In der „Natur“ des Codes und der entsprechenden Arbeitsschritte der Erstellung einer Schnittstelle wie einer Website liegt es allerdings nicht, dass diese nur quantitativ formalisierbar sein müssen. Wie in jeder Sprache sind auch im Code die Bedeutungsgehalte der Ausdrücke nicht von der Struktur der verwendeten Zeichen determiniert [vgl. der späte Wittgenstein, Qine, Austin & Co.]. Durch Informationstechnik prozessierbare Informationen müssen zwar aus Gründen der Komplexitätsreduktion exakter als Alltagssprache sein, aber nicht notwendigerweise nach den gleichen Regeln exakt wie Mathematik. Aus Gründen über die ich zunächst nur spekulieren kann (und die ich derzeit erforsche), findet in den Arbeitsschritten zu solchen Schnittstellen allerdings ein relativ radikales Blackboxing statt: Soziale Wirklichkeit wird in der Arbeitswirklichkeit von HCI’lern (akademisch oder „in der Wirtschaft“) fast ausschließlich auf quantitative Skalierungen reduziert. An die Darstellung qualitativer Ergebnisse adressiert hieße diese Problembeschreibung, dass sie nicht formalisierbar genug sind, um im Feld der HCI Anklang zu finden.
Ich finde es wichtig, nicht an dieser (unvollständigen!) Problembeschreibung stehen zu bleiben. Ich würde mich freuen, andere Erfahrungen oder Einschätzungen zu diesem Problembereich zu lesen. Ein sinnvoller nächster Schritt wäre, Punkte für eine Handlungsempfehlung („anschlussfähige(re) Darstellungsformen qualitativer Ergebnisse“) zu sammeln und zur Diskussion zu stellen. [Ergänzung: Dazu gehört natürlich auch die Frage, ob man für solche Formen der Kommunikation anschlussfähig sein will.]
Disclaimer: Danke an meinen Kollegen Michael Heidt für die anregenden Diskussionen und Hinweise, die diesem Post vorausgingen!

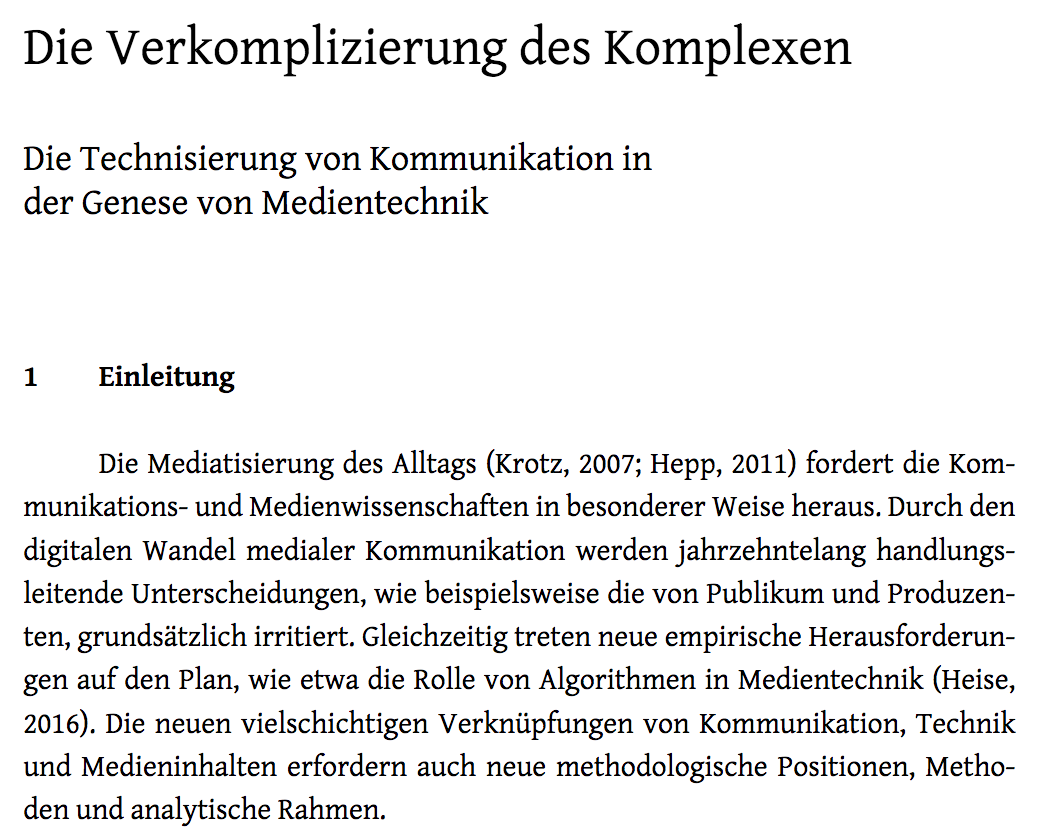
10 Kommentare
Das Problem gründet m.E. schon tiefer: ich bin letztens gefragt worden, was denn qualitative ökonomische Ziele sein könnten…von der Möglichkeit einer Operationalisierung von eben solchen wollte ich dann gar nicht erst anfangen…
Der qualitative Aspekt ist in zahlenfokussierten Unternehmen schlicht nicht präsent. Andererseits denke ich, dass die Aussagefähigkraft qualitativer Analysen, eben weil sie nicht simpel in Zahlen darstellbar ist, einer tieferen Interpretationsleistung bedarf, die durch die Entscheider nicht geleistet werden kann, da hier entsprechendes Know-How fehlt. Die Aufgabe muss deshalb aus meiner Sicht eigentlich heißen: Wie können qualitative Ergebnisse rezipientenfreundlich dargestellt werden und den gewünschten Erkenntnisgewinn ohne ein Studium der Sozialwissenschaften ermöglichen?
Wir befinden uns wahrscheinlich im Übergang zu einer neuen Zeit was das Denken „in der Wirtschaft“ angeht.
Das Rotman Magazine (Rotman School of Management / University of Toronto) veröffentlicht seit einigen Jahren Artikel wie „Informing our Intuition: Design Resarch for radical Innovation“ oder „A Survival Guide for the Age of Meaning“. Roger Martin der bis Juni der Dekan von Rotman war ist einer der bekanntesten Führsprecher für radikales Umdenken in Richtung Design-Methoden im Management-Feld. (Roger Martin@World Economic Forum http://youtu.be/i1QPq-1sRPY / Business of Design 2011@Cooper Hewitt (Designabteilung vom Smithsonian Institution) http://www.youtube.com/watch?v=NCJDVHMWnUg&list=PLBDDDC2A0B7B0FC2E / http://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/DevelopingDesignSensibilities.pdf )
z.B. Procter & Gamble hat erst vor den alten CEO A.G. Lafley zurückgeholt, der Design in die DNA des Unternehmens integriert hat (Stichworte: „Claudia Kotchka“, „Philip Duncan“). Martin und Lafley haben dieses Jahr bei „Playing to Win“ bei Harvard Business Review Press rausgebracht.
Mit „radikalem Blackboxing“ und Reduzierung auf „quantitative Skalierung“ lässt sich in Zukunft kein Geld mehr verdienen weil Prozesse auf dieser Grundlage ineffizient sind. Die Elite-Management Schulen haben man das heute schon verstanden.
Was ist mit „lean“ und „agile“?
Oder was ist mit Wireframes, Personas, Interviews, Customer-Journey-Maps und Fokus-Gruppen … sind das nicht die (Service-Design) Techniken die von Interface Designern benutzt werden (z.B. von Leuten die Apps für Banken entwerfen)?
Da Du ja versuchst mit systemtheoretischen Begriffen (Anschlussfähigkeit, Komplexitätsreduktion) zu arbeiten möchte ich ein paar Anmerkungen machen. Entschuldigung, wenn’s etwas länger geworden ist.
Zunächst müsste noch etwas präzisiert werden, warum die Erkenntnisse qualitativer Sozialforschung für Programmierer interessant sein könnten? Dies zum einen um die (unvollständige) Problembeschreibung zu vervollständigen. Zum anderen könnte das aber auch schon die ersten Hinweise darauf geben, wie eine anschlussfähige Kommunikation gelingen könnte.
Ich würde vermuten der Zweck eines Dialogs zwischen Sozialwissenschaftlern und Programmierern könnte darin liegen, dass die Ergebnisse qualitativer Sozialforschung die Arbeit von Programmieren unterstützen können. Dahinter steht die Annahme, dass es einen Überschneidungspunkt, eine Gemeinsamkeit zwischen Sozialwissenschaftlern und Programmierern gibt. Davon ausgehend ließen sich dann sowohl die wissenschaftliche und die wirtschaftliche Codierung verstehen und Ansatzpunkte finden, wie man sozialwissenschaftliche Erkenntnisse wirtschaftlich codieren könnte.
Einen gemeinsamen Schnittpunkt hast Du bereits gefunden. Du bezeichnest ihn als Mensch-Computer-Interaktion. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dies eine adäquate Beschreibung des Schnittpunktes ist. Auf die leidige Frage, ob Menschen und Computer kommunizieren, möchte ich an dieser Stelle aber nicht eingehen. Meine Überlegung geht in folgende Richtung. Die soziologische Systemtheorie setzt Gesellschaft und Kommunikation in Eins. Interaktion ist in dieser Perspektive nur die Kommunikation unter Anwesenden. Kommunikation ist immer ein selektives Geschehen an dem mindestens zwei Menschen beteiligt sind, die sowohl Erleben und Handeln. Kommunikation strukturiert damit die Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten der Beteiligten. Sozialwissenschaftler interessieren sich nun für die Formen, wie das geschieht. Programmierer sind dagegen an der Gestaltung von Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten beteiligt. Die Benutzeroberfläche eines Programms gibt bestimmte Handlungsmöglichkeiten vor und schließt andere aus. Wie diese Handlungsmöglichkeiten durch einen Benutzer erkannt werden, hängt maßgeblich davon ab, wie diese Benutzeroberfläche vom Benutzer erlebt wird. Der Idealfall ist sicherlich eine selbsterklärende Benutzeroberfläche. Doch je anspruchsvoller die Aufgabe ist, die durch ein Programm erledig werden soll, desto weniger kann die Benutzeroberfläche selbsterklärend sein. SAP kann vermutlich niemand ohne Anleitung bedienen, wenn er das erste Mal mit diesem Programm zu tun hat. Somit hängt es also in starkem Maße davon ab, wie gut ein Programmierer bestimmte Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten antizipieren kann, mit denen ein Benutzer bei der Benutzung konfrontiert werden könnte. Alle weiteren Macken werden über Tester gefunden. Computerprogramme sind damit das Ergebnis von Kommunikation mit dem Zweck Kommunikation zu technisieren.
Programmierer tun damit das, was Sozialwissenschaftler anschließend analysieren. Während, etwas überspitzt ausgedrückt, Programmierer nur Handeln, sind die Sozialwissenschaftler nur auf das Erleben bzw. Beobachten beschränkt. Handeln ist aber nicht ohne Erleben möglich. Wenn es gelingt, zu zeigen, wie das Beobachten der Sozialwissenschaftler das Handeln der Programmierer unterstützen kann, dann hätte man einen gemeinsame Basis für eine anschlussfähige Kommunikation.
Ob sich die qualitative Gestaltung einer Benutzeroberfläche in einem zu erwartenden finanziellen Gewinn quantifizieren lässt, wage ich aus dieser Perspektive allerdings zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass bei der Entwicklung von Windows 8 die Programmierer und die Controller zusammen ausgerechnet haben, wie viel Gewinn die Umstellung von der alten Benutzeroberfläche auf dieses neue Kacheldesign einbringen wird. Was ich so gehört habe, ist die Bedienung wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Windows ist mit dem Wechsel also vermutlich ein erhebliches wirtschaftliches Risiko eingegangen. Aus meiner Sicht ist es sehr fraglich, ob der Arbeitsalltag tatsächlich nur von quantitativen Faktoren bestimmt wird. Hier würde ich nochmal die Darstellungen der Programmierer hinterfragen. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass das Design der Benutzeroberfläche einen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Programms hat. Dies hängt sehr stark vom Einfühlungsvermögen bzw. der Kundenorientierung der Programmierer ab. Quantifizierbar ist dieser Einfluss aber nur in sehr begrenztem Maße, und wenn, dann erst hinterher, also wenn das Programm auf dem Markt ist. Ich würde daher vermuten, dass die Programmierer mit dem angesprochenen Übersetzungsproblem zwischen qualitativen und quantitativen Methoden wahrscheinlich tagtäglich zu kämpfen haben. Es ist damit kein Übersetzungsproblem zwischen verschiedenen sozialen Systemen, sondern zunächst eins zwischen verschiedenen Methoden der Datengewinnung und Kodifizierung, dass sich überall dort stellt, wo beide Methoden zum Einsatz kommen. Das dürften sehr viele Arbeitsfelder sein. Auch in der Sozialwissenschaft ist dieser Konflikt ja nicht unbekannt. Beide Methoden sind zugleich verschiedene Formen Erleben zu koordinieren, die dann auch unterschliche Handlungsmöglichkeiten eröffnen.
Komplexitätsreduktion ist nur eine andere Bezeichnung für die Reduktion von Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten auf ein überschaubares Maß. Qualitative und quantitative Methoden der Datenerhebung sind dann zwei verschiedene Formen dies zu tun. Die Frage wäre dann, wird dieser Gegensatz zwischen diesen beiden Methoden als unvereinbar wahrgenommen oder als zwei komplementäre, sich ergänzende Methoden der Informationsgewinnung?
Das führt wieder zur Ausgangsfrage zurück. Wie könnten Sozialwissenschaftler die Arbeit von Programmieren unterstützen – beim Design von Benutzeroberflächen oder bei der Analyse, wie der Konflikt zwischen qualitativen und quantitativen Methoden der Informationsgewinnung die Arbeit der Programmierer beeinflusst? Anschlussfähig wären sie eigentlich für beide Aufgaben.
Als Soziologe, der im Nebenfach Informatik hatte, vermute ich mal ins Blaue hinein, dass sich irgendwo zwischen KI-Ontologien, UML und objektorientierten Paradigmen auf der einen Seite und Grounded-Theorie-Kategorien und Wirkungsmodellen auf der anderen Seite eine Schnittmenge verbergen könnte. Bleibt spannend!
Ich finde ja den Zugang den die Workplace Studies gewählt haben sehr produktiv, da sind auch schöne Ergebnisse dabei herausgekommen, man sehe sich einmal an wie Flughafenterminals und Co. designed werden. Wenn man sich anschaut was bei Xerox Parc gemacht wurde (Lucy Suchman und Co), dann waren da Soziologen durchaus nicht „unerfolgreich“. Leider wurde das ja eingestellt… und da könnten die von Dir genannten Punkte als Gründe gelten können.
Ich bin auf der MuC-Facebookseite auf deinen Post zur Anschlussfähigkeit qualitativer Forschung für Informationstechnik gestoßen, der mich doch zum Nachdenken gebracht hat, da ich mich aus Sicht der Wirtschaftsinformatik an diese mangelnde Anschlussfähigkeit bereits (leider) gewöhnt habe. Leider konnte ich bei eurem Workshop nicht bis zum Ende dabei sein, daher hier ein kurzer, teilweise sicher noch unreflektierter, Kommentar aus technischer HCI-ler-Sicht:
Die abschließende Frage, ob eine Anschlussfähigkeit qualitativer Forschung überhaupt gewollt ist, erscheint mir durchaus berechtigt. Aus meiner rein persönlichen Erfahrung würde ich die Gründe einer offensichtlich mangelnden Anschlussfähigkeit in der Forschungstradition oder auch -entwicklung technisch orientierter Fachrichtungen sehen. Die Tendenz, sich einer gestaltungsorientierten Forschung zu verschreiben, scheint zu einer starken Fokussierung qualitativer Kennzahlen zu führen, die sich im wirtschaftlichen Zusammenhang vor allem in Effizienz und wirtschaftlichem Erfolg ausdrücken. Gerade die Abkehr vom behavioristischen Forschungsdesign wird offenkundig in der Form ausgelegt, qualitative Methoden zunehmend gänzlich auszuschließen. Die Wichtigkeit von Rigorosität und Evaluation müssen sicher nicht hinterfragt werden, nur ist die vielerorts vorherrschende Fokussierung auf rein quantifizierbare Größen sehr einschränkend. Qualitative Erkenntnisse werden lediglich zur Untermauerung quantitativer Aussagen hinzugezogen. Insgesamt treten damit in technisch orientierten Projekten empirische Vorgehensweisen hinter konstruktiven Forschungsstrategien zurück.
Vor diesem Hintergrund bleibt zu hoffen, dass der Wille zur Anschlussfähigkeit gegeben ist – im Feld der Mensch-Computer-Interaktion werden wir wohl kaum auf qualitative und rekonstruktiv gewonnene Erkenntnisse verzichten können.
Über weitere Meinungen, Erkenntnisse und vor allem Vorschläge anschlussfähiger Konzepte würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße aus dem Norden!
durch einen bug habe ich eben erst eure nicht-moderierten kommentare gesehen: entschuldigt bitte & vielen dank für eure beiträge!
[…] points can be understood in two (german-language) blog posts. One is pointing out the question, how qualitative data and results can be communicated more compatible for HCI projects, the other sums up a discussion on interdisciplinary communication around code between computer […]
Der Chef, Absatzsteigerung und Metrik oder
Sabotage einer Designherausforderung.
Hier ein Beitrag zu „Management Mindlessly“
http://www.youtube.com/watch?v=Ei57yFEljrI&feature=youtu.be&t=33m40s
Clayton Christensen on management – Clarendon Lectures 11th June 2013
@Said Business School, Oxford
zur frage, ob qualitative forschung für andere subsysteme, namentlich wirtschaftliche kontexte, anschlussfähig sein will bzw. wollen sollte ein artikel von hubert knoblauch im aktuellen FQS. eine der kernthesen:
Durch eine solche (im Zuge der Institutionalisierung qual. Methoden unvermeidbare) Öffnung des Wissenschaftsbetriebs hat sich auch für qualitative Forschung die „Notwendigkeit zur Standardisierung verschärft. Das drückt sich in der Forderung nach Berechenbarkeit sowie Lehr- und Lernbarkeit der qualitativen Methoden aus. […] Solange ihre paradigmatische Orientierung von der Sozialtheorie geprägt ist und solange sie von einem eigenen paradigmatischen Anspruch im Bereich der Methodologie noch so weit entfernt ist, kann Wissenschaftlichkeit nur gewährleistet sein, wenn sich die qualitative Forschung ihrer Verankerung im theoretischen Rahmen des interpretativen Paradigmas versichert. Es ist auch diese Verankerung, die die interpretative Offenheit ihrer „Wissensprodukte“ bewahrt, ihre Subjektivität anerkennt und die Kreativität befördert, die ein Garant auch für die Lebendigkeit der qualitativen Methoden ist.“
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2063/3582